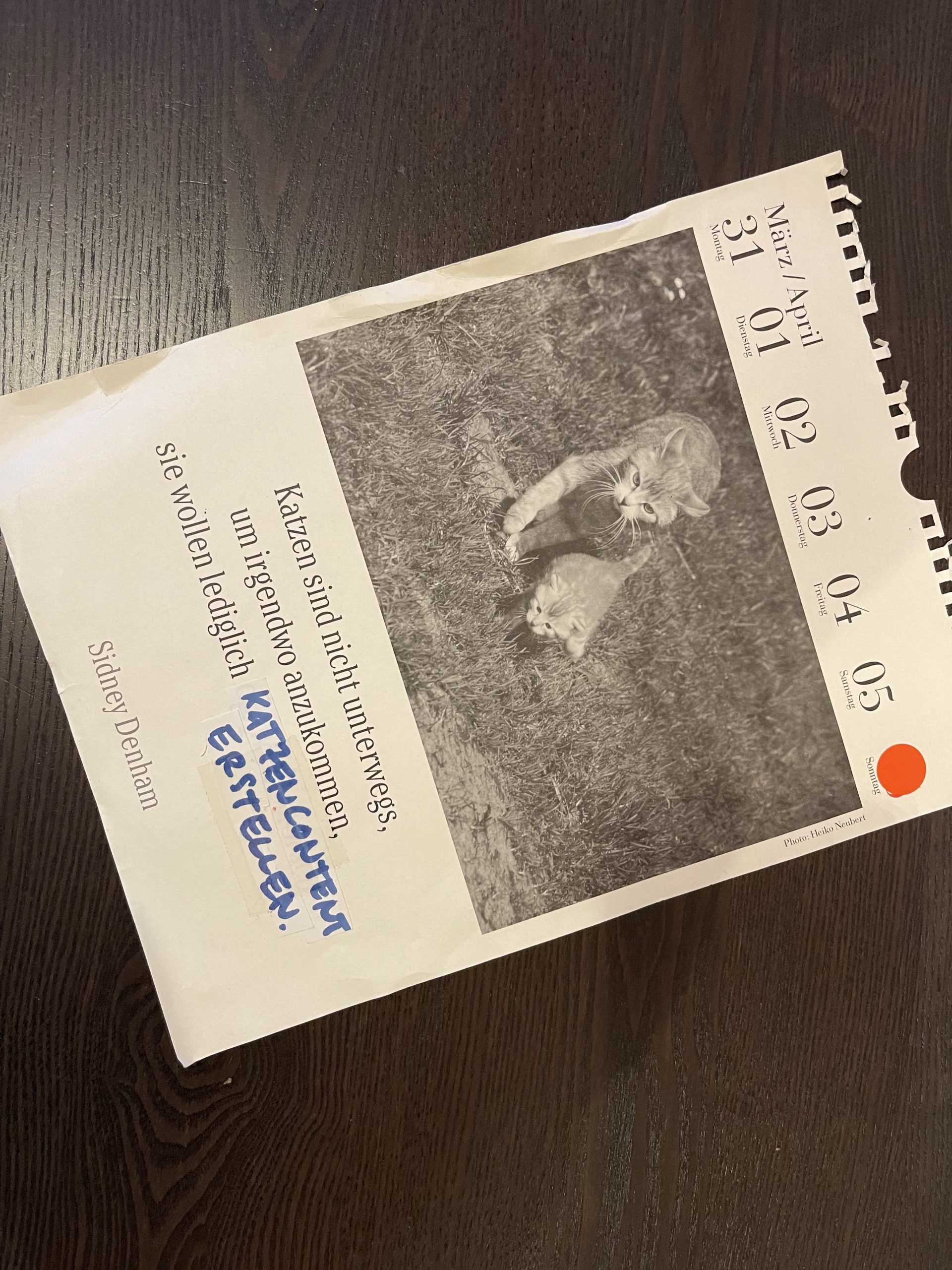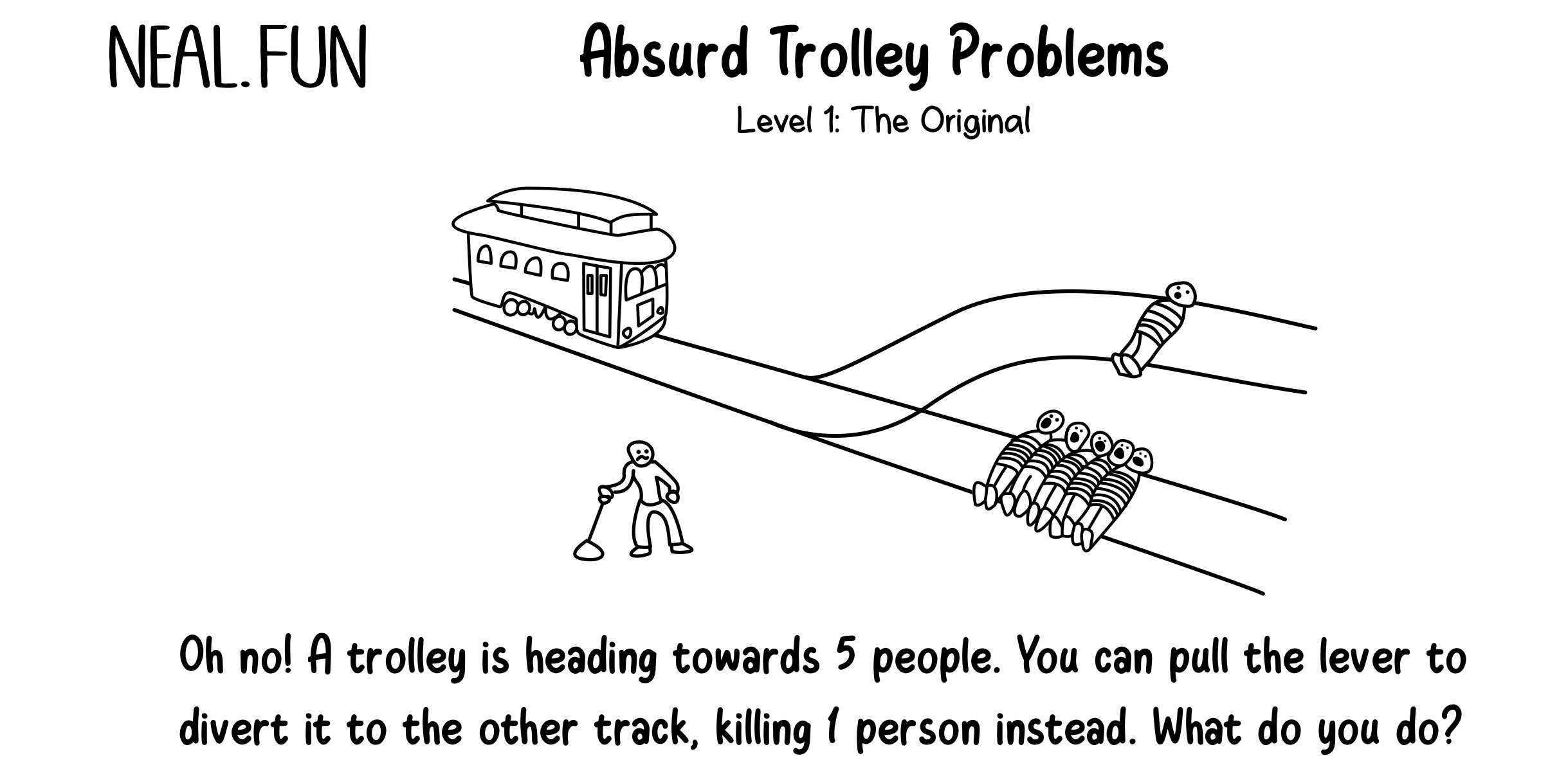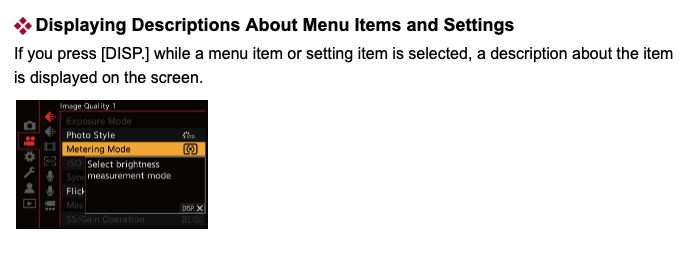Wir alle befinden uns auf einem großen Forschungsschiff, das auf einen Eisberg zusteuert.
Anstatt uns auf die bevorstehende Gefahr zu konzentrieren, streiten wir darüber, ob es wirklich ein Eisberg ist, ob es gut wäre, ihn zu treffen und warum wir überhaupt alle auf demselben Schiff sind.
Das wirkliche Problem:
Alle versuchen, das große Schiff in nur eine grobe Richtung zu steuern, anstatt viele kleine Schiffe auf unterschiedliche Erkundungsfahrten zu schicken. Das ist das Dilemma der modernen Wissenschaft.
Mit dieser Vorstellung von „großem Schiff“ verglichen mit dem „kleinem Schiff“ beleuchtet Adam Mastroianni von experimental-history.com den Kern eines Problems in der Wissenschaft.
Während alle versuchen, das große Schiff (den Hauptwissenschaftsbetrieb) zu steuern und zu reformieren, wird oft vergessen, dass wahre Entdeckungen häufig durch die „kleinen Schiffe“ gemacht werden, also individuelle und unkonventionelle Ansätze.
https://www.experimental-history.com/
Ein Schlüsselerlebnis diesbezüglich stammt aus Adams Zeit als Doktorand. Sein Doktorvater Dan Gilbert legte Wert darauf, sich nicht sofort auf Forschungsprojekte zu stürzen, sondern gemeinsam hunderte von Ideen zu diskutieren und zu verwerfen.
Erst später verstand er, dass Gilbert ihm dabei half, sein wissenschaftliches Gespür zu schärfen. Durch diese Diskussionen, das kontinuierliche Zerlegen und Neuformen von Ideen, lernte er mehr als durch jedes akademische Lehrbuch. Die gesammelten Erfahrungen glichen einem Teebeutel, der in einem Becher mit „Wissenschaftssaft“ zieht, der jeden Aspekt seines Denkens durchdringt.
Erschreckenderweise scheint diese intensive, kollegiale Form der Wissenschaftsausbildung selten zu sein. Viele Doktoranden haben nur minimalen Kontakt zu ihren Betreuern und ihnen fehlt oft die tiefe Auseinandersetzung mit ihrem Forschungsthema. Die Zeit im Gilbert-Labor hat Adam geprägt und gezeigt, wie wichtig es ist, den nächsten Generationen die Chance zu geben, sich in diesem „Wissenschaftssaft“ zu tränken.
Wissenschaft in der Öffentlichkeit
Eines der erstaunlichsten Erkenntnisse in Adams Karriere war die Entdeckung seiner eigenen Stimme als Wissenschaftler.
Jahrelang glaubte er, Schwierigkeiten zu haben, über Ideen zu schreiben. Wann immer er versuchte, einen Artikel für ein Fachjournal zu verfassen, fühlten sich die Worte falsch an. Doch als er begann, in seinem eigenen Ton für die Öffentlichkeit zu schreiben, wurde ihm bewusst, wie befreiend das sein kann. Es war nicht nur einfacher, sich auszudrücken – es entstanden ganz neue Gedanken.
Diese Transformation verstärkte sich, als er gemeinsam mit seinem Kumpel Ethan den Artikel „Things could be better“ veröffentlichte – eine echte wissenschaftliche Arbeit, verfasst in verständlicher Sprache. Als er mehr Aufrufe erhielt als seine vorherigen zwei Fachartikel zusammen, wurde ihm klar, welches Potenzial in dieser Form dieser Wisschenscahfts-Kommunikation steckt.
Es erscheint historisch absurd, dass bezahlte und perr-reviewte Journale das Monopol über wissenschaftliche Kommunikation haben. Das größte Problem dabei ist nicht nur der verlorene Zeitaufwand oder die oft langweilige Art der Darstellung, sondern wie dieses System innovative Ideen bereits im Keim erstickt. Die permanente Frage „Wird das akzeptiert?“ hemmt den freien Gedankenfluss und führt dazu, dass revolutionäre Ideen gar nicht erst entstehen. In einer Welt, die dringend neue Lösungsansätze braucht, ist das fatal.
Adams Schlussfolgerungen daraus sind klar:
- Das Erlernen wissenschaftlicher Methoden ist ein mysteriöser Prozess, bei dem man viel Zeit mit jemandem verbringen muss, der die Abläufe kennt. Nur so kann man seine Intuitionen, die wertvollsten Forschungsfähigkeiten, verfeinern.
- Wissenschaft muss ehrlich, mit persönlicher Stimme und in verständlicher Sprache ausgedrückt werden, zugänglich für alle Interessierten. Nur durch diese Freiheit können Ideen in ihrer vollen Tiefe gedeihen.
In dieser neuen Ära der Kommunikation sollten wir uns nicht länger durch traditionelle Paradigmen einschränken lassen. Es ist Zeit, die wissenschaftliche Kommunikation neu zu gestalten.
Science Houses – oder auch: Scenius der Forschung?
Wie kann man den traditionellen Wissenschaftsbetrieb revolutionieren und Forschung effizienter und menschlicher gestalten?
Adams Idee: Ein „Science House“.
Junge Forschende wohnen im Obergeschoss eines Hauses und arbeiten in Laboren im Erdgeschoss. Ihr Mentor:innen leben in der Nähe, und alle verbringen Zeit zusammen, diskutieren und forschen. Ähnlich wie bei einem Doktoratsstudium, allerdings ohne dessen stressige Aspekte. Keine Sorgen um akademische Karrieren, kein Druck, langweilige Artikel hinter Paywalls zu schreiben, keine monatelangen Prüfungsvorbereitungen. Stattdessen freier Zugang zu Forschungsergebnissen und echte, bedeutungsvolle Experimente.
Austin Kleon nennt das auch Scenius (eigentlich hat Brian Eno schon von Scenius gesprochen, aber Austion Stealt halt wie ein Artist :-D) und hat hier in seinem Newsletter einige Karten von SCenius skizziert.
Genius is an egosystem, scenius is an ecosystem.
Lustigerweise dachte ich die ganze Zeit an das, was Anne-Laure le Cunff gestern in unserem Interview für Free Range Thinking gesagt hat. Und Zack: Kommt Austin bei ihrem Artikel zum Collective Brain an 😀
Adams Vision geht aber noch weiter: Mehrere dieser „Science Houses“ könnten nebeneinander existieren, jeweils mit einem anderen Forschungsschwerpunkt, wie Psychologie, Theoretische Physik oder Botanik. Doch anstatt zu expandieren und bürokratisch zu werden, sollten sie klein und unabhängig bleiben. Diese autonomen „Little Ships“ könnten in unterschiedliche Richtungen steuern und sich dabei gegenseitig bereichern.
Derzeit erleben wir einen Trend, bei dem immer mehr Menschen außerhalb von Universitäten forschen. Sie führen Studien im Internet durch, starten Open-Access-Journale oder richten in ihren Kellern Biologielabore ein. Dieser Online-Trend benötigt einen physischen Ankerpunkt, wo Ideen geteilt und diskutiert werden können. Genau das könnten die „Science Houses“ sein: physische Begegnungsstätten für eine digitale Bewegung.
Natürlich ist dieser Ansatz nicht für alles und jeden geeignet. Manchmal benötigt die Forschung große Einrichtungen, teure Expeditionen oder ein MRT. Aber oft reicht es aus, wenn engagierte Menschen gemeinsam über Ideen brüten und experimentieren. Und das kann perfekt in einem „Science House“ passieren.
Ich muss gerade grinsen, weil Perry Knoppert letzte Woche noch erzählte, er wäre bei PHILIPS reinmarschiert und gefragt, ob er mal ein MRT haben könnte 😀
Finanziell ist das Konzept umsetzbar: Für etwa 15 Millionen Dollar könnte ein solches Haus nachhaltig finanziert werden. Zum Vergleich: Harvard gab 2022 ebenso viel nur für Porto aus. Mit dem Geld, das eine Eliteuniversität für Ablehnungsbriefe ausgibt, könnte man also eine völlig neue Art wissenschaftlicher Institution finanzieren.
Millionen-Dollar-Toiletten: Das ineffiziente System der Wissenschaftsfinanzierung
Die Finanzierung wissenschaftlicher Forschung kann teuer und ineffizient sein. Angenommen, jemand hat 100 Millionen Dollar für die Forschung zur Verfügung. Beim heutigen System geht ein Großteil dieses Geldes nicht direkt in die Forschung. Universitäten erheben sogenannte „indirekte Kosten“ von Forschungsgeldern. Zum Beispiel erhebt die Johns Hopkins University 63,75% auf Bundesmittel, die ihre Forscher einbringen. Diese „indirekten Kosten“ sollen die laufenden Kosten der Universität decken. Doch oft finanzieren sie auch nicht direkt forschungsbezogene Ausgaben.
Aber das ist nicht das Ende der Geldverschwendung. Professoren sind auf Forschungsförderung angewiesen und das Beantragen dieser Gelder ist zeitaufwändig. Viele Forschungsanträge werden abgelehnt, und die Zeit, die für die Erstellung dieser Anträge aufgewendet wird, ist oft verlorene Zeit. Forscher verbringen durchschnittlich 34 Tage pro Forschungsantrag. Schätzungen zufolge werden zwischen 10% und 35% des Forschungsbudgets für den Bewerbungsprozess selbst aufgewendet. Daher sind von den ursprünglichen 100 Millionen Dollar nach Abzug aller Kosten nur noch wenige Millionen für die eigentliche Forschung übrig.
Die aktuelle Finanzierungsstruktur fördert nicht unbedingt qualitativ hochwertige oder innovative Forschung.
Risikoreiche oder interdisziplinäre Projekte werden oft übersehen, und viele von der US-Regierung finanzierte Forschungen werden nie zitiert. Trotz all dieser Ausgaben könnten mit 100 Millionen Dollar sechs „Science Houses“ dauerhaft finanziert werden.
„Science Houses“ könnten eine revolutionäre Lösung sein. Hier würden Wissenschaftler und Forscher zusammenleben und arbeiten, mit weniger bürokratischem Aufwand und mehr Freiheit in der Forschung. Die Vision hinter „Science Houses“ ist es, jungen, talentierten Menschen Raum, Unterstützung und Freiheit zu geben, um kreativ und unabhängig zu forschen. Aktuell verlassen viele talentierte Forscher die akademische Welt, entweder weil sie die ineffiziente Struktur satt haben oder weil sie in einem so restriktiven System keinen Platz finden.
Klingt auch ein bisschen nach Startup-Haushalten.
Diese ineffiziente und restriktive Struktur der akademischen Forschungsfinanzierung hindert viele potenziell brillante Köpfe daran, ihre volle Kapazität zu nutzen. Es ist nicht nur tragisch für die Einzelpersonen, sondern auch für die Gesellschaft, die von ihren möglichen Entdeckungen profitieren könnte.
Wir sollten echt mal überlegen, wie wir alternative Modelle wie „Science Houses“ an den Start kriegen, von denen aus , die kleinen Schiffe, die von der Hauptstrecke abweichen, in See stechen und neue Horizonte entdecken könne.